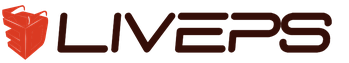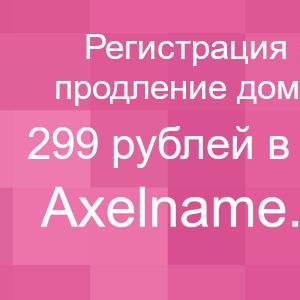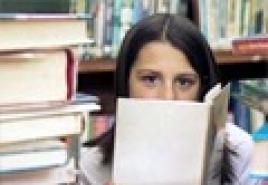König Philipp der Schöne: Biografie, Lebens- und Regierungsgeschichte, wofür er berühmt wurde. Bericht: Philipp IV., König von Frankreich, Flandernkrieg
1268–1314) französischer König (ab 1285) aus der kapetischen Dynastie. Das Territorium der königlichen Domäne wurde erweitert. Eroberte Flandern (1300), verlor es jedoch (1302) durch den Aufstand der flämischen Städte. Machte das Papsttum von den französischen Königen abhängig. Er erwirkte vom Papst die Abschaffung des Templerordens (1312). Philipp IV., ein stiller, aber sehr gutaussehender Mann, „wie eine aus Stein gemeißelte Statue“ (wie Chronisten derselben Zeit es ausdrückten), ein Mann, der viel dachte, aber sehr wenig sprach, wurde 1268 in Fontainebleau geboren. Sein Vater Philipp III. der Kühne war in erster Ehe mit Isabella von Aragon verheiratet, die ihm drei Söhne schenkte: Ludwig, Philipp der Schöne und Karl von Valois. Er heiratete 1274 zum zweiten Mal Maria von Brabant, Gräfin von Flandern, Königin von Sizilien und Jerusalem. Maria gebar ihrem Mann nur einen Sohn – Louis Graf d'Evreux. Auf Befehl der Römischen Kurie führte Philipp III. einen Feldzug nach Aragon, um den dortigen König dafür zu bestrafen, dass er es gewagt hatte, Sizilien von Karl von Anjou (dem neapolitanischen König, Vasallen und Günstling des Papstes) von Sizilien einzunehmen. Der Feldzug endete mit einer schweren Niederlage für die französische Armee und der König selbst starb auf dem Rückweg. Auch der junge Philip beteiligte sich an diesem Feldzug, obwohl er der Meinung war, dass die Kräfte des Staates nicht in den Dienst der Interessen anderer Menschen gestellt werden sollten, sondern der Größe und Macht des eigenen Landes dienen sollten. Philipp der Schöne wurde im Alter von siebzehn Jahren in Reims gekrönt. Für das Mittelalter war der Beginn der Herrschaft des jungen Philipp schockierend. Er schuf den sogenannten Königlichen Rat, der völlig über die damaligen Vorstellungen hinausging. Auch seine Vorgänger verfügten über eigene königliche Räte – diese bestanden jedoch überwiegend aus Vertretern des Adels und des hohen Klerus, unabhängig von deren Fähigkeiten und Kenntnissen. Bei der Auswahl seiner Berater ließ sich Philipp der Schöne nicht vom Adel seiner Herkunft leiten. Der größte Teil des Rates stammte aus dem Kleinadel und der aufstrebenden städtischen Klasse. Sie wurden Legalisten genannt, weil sie in der Regel gute Rechtsexperten waren und oft an mehreren Universitäten studierten (damals wurde beispielsweise in Paris nur Kirchenrecht gelehrt, in Orleans und Montpellier jedoch Gewohnheitsrecht). Darüber hinaus war der Königliche Rat Philipps des Schönen eine ständige Institution, die an eine moderne Regierung erinnerte. Einige Historiker werfen dieser Institution vor, dass sie aus „unedlen“ Menschen, „Parvenus“, bestand. Das stimmte nicht ganz: Neben ihnen war auch der höchste Adel im Rat vertreten. Sogar der Bruder des Königs, Karl von Valois, und später die Söhne des Königs waren im Rat. Gleichzeitig kann kein Historiker diesen „Parvenüs“ außergewöhnliche administrative und organisatorische Fähigkeiten und den Wunsch, das Kapetinger Königreich zu einem starken Staat zu machen, leugnen. Eine wichtige Rolle in Philipps Politik spielten seine Mitarbeiter: Kanzler Pierre Flotte, Siegelhüter Guillaume Nogaret und Koadjutor des Königreichs Enguerrand Marigny. All dies waren bescheidene Menschen, die vom König selbst zu höchsten Macht erhoben wurden. Unter Philipp dem Schönen wird Paris zur Hauptstadt im wahrsten Sinne des Wortes. Im Zentrum der Stadt, im westlichen Teil der Insel Cité an der Seine, begann der Bau eines prächtigen Architekturkomplexes. Es umfasst den königlichen Palast, den Sitzungssitz seines Rates, das Pariser Parlament (so hieß der Hof damals) und später die Gremien der Klassenvertretung. Der Bau dieses Komplexes dauerte viele Jahre und wurde kurz vor dem Tod Philipps des Schönen abgeschlossen. Es entsteht ein durchdachtes System der öffentlichen Verwaltung. Es entstand ein Institut königlicher Beamter, die die Gerichts- und Verwaltungsbezirke leiteten: in Nordfrankreich – Gerichtsvollzieher, in Südfrankreich – Seneschalle. Gleichzeitig verwalten Pariser Institutionen das gesamte Verwaltungssystem in Frankreich. Im Falle einer Meinungsverschiedenheit mit ihrem Handeln konnte man sich an den König wenden. Offenbar war sich Philipp der Schöne der wachsenden Bedeutung seiner Macht bewusst. „Er ist König, Kaiser und Papst in seinem Land“, charakterisierte der aragonesische Botschafter am französischen Hof Philipp IV. Philipp geriet häufig mit dem englischen König Eduard I. in Konflikt. 1295 berief er seinen Gegner als seinen Vasallen an den Hof des Pariser Parlaments. Edward weigerte sich, sich zu unterwerfen, und ihm wurde der Krieg erklärt. Als Papst Bonifatius VIII. davon erfuhr, verpflichtete er beide Monarchen, einen Waffenstillstand zu schließen. Allerdings folgten weder Philipp IV. noch Eduard I. seiner Forderung. Diese Episode beginnt mit dem dramatischen Duell zwischen Philipp dem Schönen und Bonifatius VIII. Dabei geht es nicht um Fragen der Religion und der Kirche (es scheint sogar, dass der König ein viel gläubigerer Katholik war als der Papst), sondern um Macht und Geld. Philipp der Schöne und Eduard suchten nach Verbündeten im bevorstehenden Krieg. Kaiser Adolf, die Grafen von Flandern, Geldern, Brabant und Savoyen sowie der König von Kastilien erklärten ihre Bereitschaft, auf der Seite Eduards zu handeln. Philipps Verbündete waren der Graf von Burgund, der Herzog von Lothringen, der Graf von Luxemburg und die Schotten. Von allen aufgeführten Personen hatten jedoch nur der Schotte und Graf von Flandern Guy Dampierre einen wirklichen Einfluss auf die Ereignisse. Edward selbst, der mit einem schwierigen Krieg in Schottland beschäftigt war, schloss einen Waffenstillstand mit Philipp (1297) und dann Frieden (1303), wonach Guienne dem englischen König überlassen wurde. Im Jahr 1297 fiel die französische Armee in Flandern ein. Philipp selbst belagerte Lille und Graf Robert von Artois errang einen Sieg bei Fournes (hauptsächlich dank des Verrats des Adels, unter dem sich viele Anhänger der französischen Partei befanden). Danach ergab sich Lille. Im Jahr 1299 eroberte Karl von Valois Douai, zog über Brügge und marschierte im Mai des folgenden Jahres in Gent ein. Er stieß nirgendwo auf Widerstand. Graf Guy ergab sich zusammen mit seinen beiden Söhnen und 51 Rittern. Der König beraubte ihn als Rebellen seiner Besitztümer und annektierte das reiche Flandern seinem Königreich. Im Jahr 1301 bereiste Philipp neue Besitztümer und wurde überall mit Unterwerfungsbekundungen begrüßt. Doch er versuchte sofort, den größtmöglichen Nutzen aus seiner Neuerwerbung zu ziehen und erlegte dem Land exorbitante Steuern auf. Unter Philipp dem Schönen spielte Geld eine übermäßig große Rolle: Wachsende Tribute, Steuern und Zehnten brachten dem König den wenig schmeichelhaften Spitznamen „Fälscherkönig“ ein (beim Prägen von Münzen begann er, den Metallgehalt in ihnen zu reduzieren). Dies löste Unmut aus, und die harte Regierung des Franzosen Jacques von Chaillon steigerte den Hass auf die Invasoren weiter. Als in Brügge Unruhen begannen, verurteilte Jacques die Verantwortlichen zu hohen Geldstrafen, ordnete den Einbruch der Stadtmauer und den Bau einer Zitadelle in der Stadt an. Im Mai 1302 brach ein zweiter, viel mächtigerer Aufstand aus. Innerhalb eines Tages töteten die Menschen in der Stadt 1.200 französische Ritter und 2.000 Soldaten. Danach griff ganz Flandern zu den Waffen. Im Juni näherte sich eine französische Armee unter der Führung von Robert Artois. Aber in einer hartnäckigen Schlacht bei Courtray wurde es besiegt. Zusammen mit ihrem Kommandanten fielen bis zu 6.000 französische Ritter. Tausende von Toten abgenommene Sporen wurden als Siegestrophäen in der Mastrichter Kirche aufgetürmt. Philip konnte eine solche Schande nicht ungestraft lassen. Im Jahr 1304 näherte sich der König an der Spitze einer 60.000 Mann starken Armee den Grenzen Flanderns. Im August wurden die Flamen in einer hartnäckigen Schlacht bei Mons-en-Null besiegt, zogen sich aber geordnet nach Lille zurück. Philipp schloss Frieden mit dem Sohn von Guy Dampierre, Robert von Bethune, der in seiner Gefangenschaft war. Philipp erklärte sich bereit, ihm das Land zurückzugeben und die Rechte und Privilegien der Flamen zu wahren. Für die Freilassung ihres Grafen und anderer Gefangener mussten die Städte jedoch eine hohe Entschädigung zahlen. Als Pfand für die Zahlung des Lösegelds nahm der König Ländereien am rechten Ufer der Leie mit den Städten Lille, Douai, Bethune und Orsha. Er verpflichtete sich, sie nach Erhalt des Geldes zurückzugeben, verstieß jedoch heimtückisch gegen die Vereinbarung und überließ sie für immer Frankreich. Wie oben erwähnt, spielte Geld eine entscheidende Rolle im Streit zwischen Philipp dem Schönen und Bonifatius VIII. Die vom französischen König durchgeführten Reformen im Staatsapparat sowie der Krieg in Guienne und Flandern kosteten viel Geld. Deshalb erhob Philipp der Schöne (und der englische König Eduard I.) eine Steuer auf Kirchenbesitz. Der Papst lehnte diese Entscheidung scharf ab und verbot Geistlichen in England und Frankreich durch eine Sonderbulle von 1296 die Zahlung „weltlicher“ Steuern. Als Reaktion darauf begannen die französischen und englischen Könige, denen, die die Befehle des Papstes ausführten, Ländereien wegzunehmen. Philipp der Schöne ging noch einen Schritt weiter und verbot die Bereitstellung von Geldern aus dem Königreich für den Unterhalt des päpstlichen Hofes. Doch als zwei Jahre später der französische und der englische König Frieden schlossen und ihre Verbindung sogar mit familiären Bindungen besiegelten – Philipps Tochter Isabella wurde die Frau von Eduards Sohn und Nachfolger –, wurde Eduard II., der Papst, offiziell zu den französisch-englischen Friedensverhandlungen eingeladen gezwungen, sich vorübergehend zurückzuziehen. Gerade zu dieser Zeit hatte er mit dem starken Widerstand der Kardinäle zu kämpfen. Philipp der Schöne entschied, dass er dem Papst nicht einmal erlauben würde, sich in die kirchlichen Angelegenheiten seines Landes einzumischen. Im Süden Frankreichs widersetzte sich der königliche Hof den Bischöfen, die sich weigerten, Tribut für Kirchenbesitz zu zahlen. Im Jahr 1301 erließ der Papst mehrere Bullen gleichzeitig, in denen er das Verhalten des französischen Königshofes scharf verurteilte und die Einberufung eines allgemeinen Kirchenkonzils in Rom ankündigte, wo er zusammen mit den französischen Prälaten und Bischöfen die Absicht hatte, zu verurteilen und bestrafe Philipp den Schönen. Als Reaktion darauf organisierten die königlichen Legisten schnell praktisch das erste französische Ständeparlament, das nicht nur die päpstlichen Bullen ablehnte, sondern auch Bonifatius VIII. (nach dem Vorbild der römischen Opposition der Kardinäle) zweifelhafter Legitimität und Häresieverdacht beschuldigte. Doch gerade zu dieser Zeit brach in Flandern der oben erwähnte Aufstand aus. Bonifatius VIII. jubelte nach der Schlacht bei Courtray. Auf der feierlichen Synode verkündete er eine pompöse Bulle, in der er das Recht der Kirche begründete, „mit beiden Schwertern“ zu herrschen. Bonifatius befahl seinem Legaten in Frankreich, Philipp den Schönen zu verfluchen. Der König sperrte den Legaten jedoch ein und verbrannte den Stier. Von diesem Moment an nehmen die Ereignisse eine dramatische Wendung. Clevere Juristen nutzen die Situation aus und erheben bei neuen „Klassenversammlungen“ sowohl wahre als auch erfundene Anschuldigungen gegen den Papst wegen Verbrechen gegen das Königreich. Auf diese Weise gelang es ihnen, Universitäten, Klöster und Städte für sich zu gewinnen; Es werden Stimmen laut, die die Einberufung eines Kirchenrats und die Absetzung des unwürdigen Papstes fordern. Diesmal sollte das Konzil nicht in Rom, sondern in Frankreich stattfinden. Eines der prominentesten (und schlauesten) Mitglieder des königlichen Rates, der Legist Guillaume Nogaret, wurde mit einer Vorladung zu einem Kirchenrat zum Papst geschickt. Bonifatius befand sich zu dieser Zeit jedoch nicht in Rom, sondern in seiner Heimatstadt Anagni, wo er sich darauf vorbereitete, eine neue Bulle anzukündigen, die den endgültigen Fluch über Philipp den Schönen verkündete. Bonifatius VIII. empfängt einen ungebetenen Gast in seinem Schlafzimmer. Kurz nach diesem Besuch stirbt der Papst. Laut dem Historiker Favier gab ihm jemand eine Ohrfeige. Wer – es wurde nie geklärt, obwohl behauptet wird, dass es Nogare Bonifatius VIII. war, der diese Demütigung kurzzeitig überlebte – ist möglich, dass sein schneller Tod die Folge eines mentalen Schocks durch einen solchen Angriff war. Viele französische Historiker versuchten, Nogaret von wenig schmeichelhaften Verdächtigungen zu befreien und römischen Dienern die Schuld für den Vorfall im päpstlichen Schlafzimmer zu geben. Doch trotz ihrer Bemühungen behielt Nogaret den Ruf des Mannes, der „den Papst geohrfeigt“ hatte. Der neue Papst Benedikt XI. exkommunizierte Nogaret aus der Kirche, stoppte jedoch die Verfolgung Philipps selbst. Im Sommer 1304 verstarb auch er. An seiner Stelle wurde der Erzbischof von Bordeaux, Bertrand du Gotha, gewählt, der den Namen Clemens V. annahm. 1309 ließ er sich in Avignon nieder und gründete hier die päpstliche Residenz. Bis zu seinem Tod blieb er ein gehorsamer Testamentsvollstrecker des französischen Königs. Clemens V. widerrief alle Bullen Bonifatius gegen Philipp und verlegte seinen Hof schließlich nach Avignon. Ende des 12. Jahrhunderts ließen sich zahlreiche Kaufleute aus der Lombardei in Frankreich nieder, vor allem in Paris. Daher erhielten im Mittelalter alle Geldverleiher und Pfandleiher die Sammelbezeichnung „Pfandleiher“. Zu ihnen gesellten sich Geschäftsleute französischer Herkunft und Juden, die demselben Handwerk nachgingen. Im Jahr 1306 verhängte Philipp der Schöne Sanktionen gegen die Wucheraktivitäten der Langobarden, beschlagnahmte schamlos Eigentum, weitete seine Unterdrückung dann auf die Juden aus und vertrieb sie aus Frankreich. Die Bevölkerung, viele von ihnen waren Schuldner jüdischer Pfandleiher und Geldverleiher, begrüßte diese drakonischen Maßnahmen mit Begeisterung. Am 15. Mai 1307 sprach Philipp der Schöne in Poitiers mit seinem Schützling Papst Clemens V. Bei diesem Treffen erhob der König erstmals Vorwürfe gegen den Templerorden. Der Templerorden entstand zu Beginn des 12. Jahrhunderts in Jerusalem, seine Mitglieder nannten sich Kirchenritter. Sie kümmerten sich um die Grabeskirche und waren während der Kreuzzugszeit militärisch organisiert. Darüber hinaus bewachten die Templer die Schatzkammer – sowohl ihre eigene als auch die von Herrschern oder einfach nur Privatpersonen. Mit dem Rückzug der Kreuzfahrer aus dem Heiligen Land verlagerte sich der Schwerpunkt der Aktivitäten der Templer vom militärischen in den finanziellen Bereich. In allen größeren Städten gab es sogenannte Tempel, bei denen es sich im Wesentlichen um Bankhäuser handelte. Die Schätze des Ordens – und zwar große – erreichten in den Legenden und Gerüchten, die über sie kursierten, unglaubliche Ausmaße und wurden zum Neid der Hauptkonkurrenten der Templer – der italienischen Bankiers. Am Freitag, dem 13. Oktober 1307 (Julianischer Kalender), nahm Philipp der Schöne eine plötzliche Verhaftung der Templer in ganz Frankreich vor. Ihnen wurde Kreuzschändung, Götzendienst und Sodomie vorgeworfen. Es ist möglich, dass der König vieles von dem glaubte, was im Volk über die Templer gesagt wurde (ihnen wurden Säkularismus und Stolz, dunkle Rituale und vieles mehr vorgeworfen). Der Hauptgrund für sein Eingreifen dürfte jedoch darin liegen, dass er sich, wie auch bei Streitigkeiten mit Bonifatius, für den auserwählten Verteidiger des Christentums, den christlichsten König hielt, dessen Recht und Pflicht darin bestand, direkt in die Angelegenheiten der Kirche einzugreifen. Zunächst versuchte Philipp, Papst Clemens V. gegen die Templer aufzuhetzen, doch als dieser keine Lust zum Handeln zeigte, nahm er das Schicksal des Ordens selbst in die Hand. Vermutlich spielte Geld wieder eine große Rolle bei der Entscheidung des Königs. Philipp der Schöne schuldete den Templern riesige Geldsummen. Der „Prozess“, dem mehrere hundert Templer ausgesetzt waren, bestand aus Folter, falschen Gnadenversprechen und der Erzwingung von Geständnissen aller möglichen Verbrechen. Während eines solchen „Prozesses“ gab der Großmeister des Ordens, Jacques Molay, selbst zu, Christus zu verleugnen und auf das Kreuz zu spucken. Als Clemens V. den schüchternen Wunsch zeigte, einen kirchlichen Inquisitionsprozess zu organisieren, begannen alle Templer, ihren Prozess aufzugeben. Geständnisse. Auf königlichen Befehl wurden mehr als fünfzig Mitglieder des Ordens auf dem Scheiterhaufen verbrannt, „weil sie anerkannte Verbrechen abgelehnt hatten“. Clemens V. berief im Oktober 1311 einen allgemeinen Kirchenrat in der Stadt Vienne ein. Auf Druck des französischen Gerichts wurde beschlossen, den Templerorden abzuschaffen und seinen Besitz zu beschlagnahmen, was im April 1312 geschah. Ursprünglich sollten die beschlagnahmten Gelder an einen anderen Orden übertragen und für die Organisation neuer Kreuzzüge verwendet werden, doch der größte Teil dieses riesigen Vermögens ging an Philipp selbst und andere Monarchen. Auf Anraten des Königs verboten sie auch den Templerorden in ihren Territorien und profitierten von deren Reichtum. Auch der Großmeister des Ordens, Jacques Molay, wurde verbrannt. Wie später von Mund zu Mund weitergegeben wurde, sagte er vor seinem Tod Clemens V. und Philipp IV. dem Schönen voraus, dass sie einer in vierzig Tagen und der andere in zwölf Monaten vor dem Obersten Richter erscheinen würden. Das Feuerelement erledigt den Rest. Und die Vorhersage wurde wahr. Zunächst starb der Papst an Ruhr und Erbrechen. Dies geschah auf Roque More im Rhonetal am 20. April 1314, im neunten Jahr seines Pontifikats, oder nach dem gregorianischen Kalender am 1. Mai, St. Philippa. Genau dreiunddreißig Tage sind seit dem Märtyrertod von de Molay vergangen. Philipp der Schöne starb am Freitag, dem 29. November 1314, in Fontainebleau, wohin er sich Anfang des Monats transportieren ließ. Es ist merkwürdig, dass der „Phebic-Kalender“ der Astrologen diesem Tag den symbolischen Namen „Haus in Flammen“ gibt. Genau 255 Tage liegen zwischen dem Autodafé auf der Judeninsel und dem Todeskampf Philipps. Beide, der Papst und der König, starben zu dem Zeitpunkt, der in de Molays letztem Fluch angegeben ist. Die Stimme der Vergeltung, die aus den Flammen des Feuers erklang, traf nicht nur den Papst und den König. Der Fluch hinterließ ein jahrhundertealtes Siegel bei allen Nachkommen Philipps IV. des Schönen. Aufgrund ihrer Ausschweifungen schenkten die Frauen seiner Familie der Welt großzügig uneheliche Kinder, die später, nicht ohne Humor, Kinder des „Willens Gottes“ genannt wurden.
Hervorragende Definition
Unvollständige Definition ↓
PHILIPUS IV. DER SCHÖNE
1268–1314) französischer König (1285–1314) aus der kapetischen Dynastie. Das Territorium der königlichen Domäne wurde erweitert. Machte das Papsttum von den französischen Königen abhängig (Eroberung der Päpste durch Avignon). Einberufung der ersten Generalstände (1302). Er erwirkte vom Papst die Abschaffung des Templerordens (1312). Philipp der Schöne wurde 1268 in Fontainebleau geboren. Sein Vater, Philipp III. der Kühne, war in erster Ehe mit Isabella von Aragon verheiratet, die ihm drei Söhne gebar: Ludwig, Philipp der Schöne und Karl von Valois. Zum zweiten Mal heiratete er Maria von Brabant, Gräfin von Flandern, Königin von Sizilien und Jerusalem. Philipp IV. wurde im Alter von siebzehn Jahren in Reims gekrönt. Er kam nach dem Tod seines Vaters während eines Feldzugs in Aragon an die Macht. Im Jahr 1284 heiratete Philipp Johanna, Königin von Navarra und Gräfin der Champagne. Aus dieser Ehe hatte er drei Söhne – Ludwig X. den Mürrischen, Karl IV. den Schönen und Philipp V. den Langen – und eine Tochter Isabella. Unter Philipp IV. wurde der Grundstein für die gesamte weitere französische Diplomatie gelegt. Seine Regierungszeit war geprägt von einer Vielzahl von Verhandlungen, die entweder auf Gebietserwerbe oder umgekehrt auf die Verhinderung von Kriegen abzielten. All dies trug zur Entwicklung und Verbesserung der französischen Diplomatie bei. Sie begann eine sehr wichtige Rolle zu spielen, indem sie gewinnbringende Allianzen schloss und mächtige Koalitionen ins Leben rief. Bisher beschränkten sich die diplomatischen Beziehungen Frankreichs zum Ausland auf seltene und kurzfristige Missionen. Die Verhandlungen wurden überwiegend mündlich geführt. Erst unter Philipp wurden schriftliche diplomatische Beziehungen aufgenommen, und Botschaften kamen häufig vor. Die sizilianischen und aragonesischen Probleme, die Philipp der Schöne von seinem Vater geerbt hatte, wurden diplomatisch gelöst. Er stellte die Feindseligkeiten sofort ein und unterstützte nicht die Ansprüche seines Bruders Karl von Valois, der davon träumte, König von Aragonien (oder Sizilien) zu werden. Um den Konflikt zu lösen, wurde 1291 in Tarascon sogar ein echter internationaler Kongress einberufen – so etwas wie die Kongresse der Neuzeit –, auf dem Vertreter des Papstes, französischer, englischer, neapolitanischer und aragonesischer Könige anwesend waren und auf dem gesamteuropäische Angelegenheiten behandelt wurden wurden besprochen. Im Verhältnis zum englischen König Eduard I. war Philipps Politik härter. Zwischen den Untertanen beider Staaten kam es häufig zu Konflikten. Philipp nutzte eine davon aus und berief 1295 den englischen König als seinen Vasallen an den Hof des Pariser Parlaments. Edward weigerte sich, sich zu unterwerfen, und ihm wurde der Krieg erklärt. Doch bereits 1297 schloss Eduard, der mit einem schwierigen Krieg in Schottland beschäftigt war, einen Waffenstillstand mit Philipp und 1303 einen Frieden, wonach Guienne dem englischen König überlassen wurde. Die Könige besiegelten ihre Verbindung sogar mit familiären Bindungen – Philipps Tochter Isabella wurde die Frau von Edwards Sohn und Nachfolger Edward II. Und sowohl in der Außenpolitik als auch in der Innenpolitik folgte Philipp IV. dem Rat seiner Legalisten, deren Aufstieg in den Reihen ihm ausschließlich zu verdanken war. Dies waren hauptsächlich kleine Ritter oder Leute aus dem Bürgertum, frischgebackene Adlige. Mit Hilfe von Legalisten, die in den meisten Fällen an juristischen Fakultäten in Italien und Frankreich ausgebildet wurden und zu erfahrenen Verteidigern königlicher Interessen wurden, versuchte Philipp, seine grandiosen internationalen Pläne zu verwirklichen. Er setzte sie vor allem mit Hilfe diplomatischer Kunst und nicht mit Waffen in die Tat um. Der französische König gab seinen Beschlagnahmungen gerne eine äußerlich legale Form. Aus diesem Grund verbreiteten sich Prozesse unter ihm so sehr. Fast jedes größere Vorhaben während der Herrschaft Philipps IV. erfolgte in Form eines Prozesses. Seine Anwälte, die unter verschiedenen Namen agierten – „königliche Notare“, „Königsritter“, „Königsmänner“ – und bei der Verteidigung der Interessen des Königs Gesetzlosigkeit begingen, versteckten sich ausnahmslos hinter dem Schein des Gesetzes. Frankreich verwandelte sich in eine starke feudale Monarchie, was zu einem Konflikt mit dem Papsttum führte, das sich nach dem Sieg über das Heilige Römische Reich weiterhin kraftvoll in die Angelegenheiten der europäischen Herrscher einmischte und die Vorherrschaft in Europa und „der ganzen Welt“ beanspruchte. In der Konfrontation mit Papst Benedikt VIII. kam das diplomatische Talent Philipps IV. voll zur Geltung. Bonifatius VIII. wurde im Dezember 1294 im Alter von 76 Jahren auf den päpstlichen Thron gewählt. Als Experte für Kirchenrecht zeichnete er sich durch außergewöhnliche Geschicklichkeit in der Wirtschaft aus und war bekannt für seine unerschöpfliche Energie und Hartnäckigkeit bei der Verteidigung der Ideen der päpstlichen Vorherrschaft. Die vom französischen König eingeführten Reformen im Staatsapparat sowie der Krieg an praktisch zwei Fronten mit England in Guienne und Flandern kosteten viel Geld. Daher erhob Philipp (wie auch der englische König Eduard I.) eine Steuer auf Kirchenbesitz. Bonifatius reagierte 1296 mit einer gewaltigen Bulle, in der er unter Androhung der Exkommunikation verbot, weltlichen Herrschern Steuern vom Klerus zu erheben, und dem Klerus, ohne päpstliche Erlaubnis irgendetwas zu zahlen. Dieses Verbot verletzte eines der Grundrechte des Monarchen. Dann begannen die französischen und englischen Könige, jedem, der dem Papst gehorchte, die Güter wegzunehmen. Philipp ging sogar noch weiter: Durch ein besonderes Dekret verbot er den Export von Gold und Silber aus dem Königreich, wodurch die römische Kurie alle Einnahmen aus Frankreich verlor. Es folgte eine scharfe Kontroverse: empörte Botschaften des Papstes und anonyme Broschüren von Verfechtern königlicher Interessen. Als jedoch zwei Jahre später der französische und der englische König Frieden schlossen, musste der Papst, der offiziell zu den französisch-englischen Friedensverhandlungen eingeladen wurde, vorübergehend zurücktreten. Zu dieser Zeit kämpfte er gegen den starken Widerstand der Kardinäle, angeführt von den Colonnas. Bonifatius befürchtete, dass sich die Kolonnen mit dem französischen König verbünden würden. Philipp IV. bedrohte den Papst mehrere Jahre lang ständig mit einem Bündnis mit seinen schlimmsten Feinden in Italien und gewährte dem Papst gleichzeitig gelegentlich die finanzielle Unterstützung, die er so sehr brauchte. Bonifatius VIII. gelang es dennoch, die Opposition zu unterdrücken. Dieser Erfolg sowie die großen Pilgerströme, die anlässlich des 1300-Jahr-Jubiläums nach Rom kamen, ließen ihn seine Stärke spüren. Er erschien vor Zehntausenden versammelten Menschen und verkündete auf trotzigste Weise seinen Anspruch auf die höchste Macht in weltlichen Angelegenheiten. Der französische König entschied jedoch, dass er dem Papst nicht nur erlauben würde, sich in die weltlichen, sondern sogar in die kirchlichen Angelegenheiten seines Landes einzumischen. Im Jahr 1301 weitete sich der vorangegangene Streit um die Besteuerung des Klerus zu einem allgemeinen Streit um die Rechte des päpstlichen Throns und des französischen Königs aus. Ein weiterer Grund für die Verschlechterung der Beziehungen war der Fall des päpstlichen Legaten, der nach Philipp geschickt wurde, um Geld für den Kreuzzug zu sammeln, und in Frankreich festgehalten wurde. Der päpstliche Legat, Bischof von Pamiers Bernard Sesse, der keine Zugeständnisse erzielen konnte, begann Philipp mit einem Interdikt zu drohen. Philipp befahl, den Legaten zu verhaften und in Sanly in Gewahrsam zu nehmen. Er forderte den Papst auf, Bernhard abzusetzen und ihn vor ein weltliches Gericht stellen zu lassen. Der Papst reagierte, indem er auf der sofortigen Freilassung des Legaten bestand. Bonifatius entzog dem französischen König das Recht, Steuern vom Klerus einzutreiben, und verbot dem französischen Klerus, ohne Erlaubnis des Papstes irgendetwas an den König zu zahlen. Er beschuldigte Philipp IV. der Beschlagnahmung von Kircheneigentum, tyrannischer Handlungen und anderer Vergehen und verkündete seine Entscheidung, den französischen Klerus zu einem Kirchenrat einzuberufen, der am 1. November 1302 in Rom eröffnet werden sollte. Bonifatius schlug vor, dass der König selbst dort erscheinen oder seine Vertreter schicken sollte. „Aber“, endete der Bulle, „wir werden es auch im Falle Ihrer Abwesenheit nicht versäumen, es durchzuführen.“ Und Sie werden Gottes Urteil durch unsere Lippen hören.“ Philipp befahl, diesen Stier auf der Veranda der Kathedrale Notre Dame feierlich zu verbrennen. Es folgte ein geschickter Feldzug gegen den Papst, organisiert von berühmten Legalisten. Es wurden Fälschungen verwendet: fiktive päpstliche Bullen und die fiktiven Antworten des Königs darauf. Diese Fälschungen wurden von vielen als Wahrheit angesehen. Die Legalisten spielten mit nationalen Gefühlen und stellten die Angelegenheit als Bonifatius' Wunsch dar, Frankreich in einen Vasallenstaat zu verwandeln. Universitäten, Klöster und Städte stellten sich auf die Seite des Königs, es wurden Stimmen laut, die forderten, einen Kirchenrat einzuberufen und den unwürdigen Papst abzusetzen. Diesmal sollte das Konzil nicht in Rom, sondern in Frankreich stattfinden. Bonifatius blieb nicht rechtzeitig stehen, sondern bekämpfte diese Welle des Nationalgefühls und beging eine fatale Fehleinschätzung. Im April 1302 berief Philipp IV. die ersten Generalstände in Paris ein. An ihnen nahmen Vertreter des Klerus, Barone und Staatsanwälte der wichtigsten nördlichen und südlichen Städte teil. Um die Empörung der Abgeordneten zu erregen, wurde ihnen eine gefälschte päpstliche Bulle vorgelesen, in der die Ansprüche des Papstes bekräftigt und verschärft wurden. Anschließend wandte sich Kanzler Flott mit der Frage an die Delegierten: Kann der König auf die Unterstützung der Stände zählen, wenn er Maßnahmen ergreift, um die Ehre und Unabhängigkeit des Staates zu schützen und die französische Kirche von der Verletzung ihrer Rechte zu befreien? Die Staaten unterstützten die Linie des Königs. Im Mai 1302 brach in Flandern ein Aufstand aus, der durch die hohe Steuerlast verursacht wurde. In der berühmten „Sporenschlacht“ bei Kortrijk fügten die Milizen der flämischen Städte den königlichen Rittern eine schwere Niederlage zu. Ganz Flandern wurde von den Franzosen befreit. Dann reagierte Bonifatius, inspiriert von der Niederlage Philipps IV., auf die Entscheidung der Generalstände mit der berühmten Bulle, die das päpstliche Maximalprogramm formulierte. Es gibt zwei Schwerter – geistlich und weltlich. Das geistliche Schwert liegt in den Händen des Papstes, das weltliche Schwert in den Händen der Herrscher, aber die Herrscher können es nur für die Kirche verwenden, entsprechend dem Willen des Papstes. „Die geistige Macht muss die irdische Macht errichten und sie beurteilen, wenn sie vom wahren Weg abgewichen ist …“ Die Unterwerfung unter den Papst wurde zum Dogma des Glaubens erklärt, und nicht nur der rebellische Philipp, sondern das gesamte französische Volk wurde für beraubt erklärt Erlösung, wenn sie sich nicht dem Willen Bonifatius beugten. Im April 1303 exkommunizierte der Papst den König und befreite die sieben Kirchenprovinzen im Rhonebecken von der Vasallenschaft und vom Treueeid gegenüber dem König. Dann erklärte Philipp Bonifatius zum falschen Papst (tatsächlich gab es einige Zweifel an der Rechtmäßigkeit seiner Wahl), zum Ketzer und sogar zum Hexenmeister. Bonifatius war zu weit gegangen: Weder Könige noch Völker ließen sich durch Anathemas einschüchtern. Die Legalisten verarbeiteten die öffentliche Meinung entsprechend: Die Abgesandten des Königs huschten durch ganz Frankreich und überzeugten seine Untertanen von der Richtigkeit von Philipps Handeln. Der französische König forderte die Einberufung eines ökumenischen Konzils, sagte aber gleichzeitig, dass der Papst als Gefangener und Angeklagter bei diesem Konzil anwesend sein sollte. Von Worten ging er zur Tat über. Eines der prominentesten (und schlauesten) Mitglieder des königlichen Rates, der Legist Guillaume Nogaret, wurde mit einer Vorladung zu einem Kirchenrat zum Papst geschickt. Bonifatius lebte zu dieser Zeit jedoch nicht in Rom, sondern in seiner Heimatstadt Anagni (wo er sich einigen Quellen zufolge zurückzog und sich vor dem von den Kolonnen angeführten römischen Adel versteckte), wo er sich am 8. September auf seine Ankündigung vorbereitete ein neuer Bulle, der den letzten Fluch über Philipp verkündet. Doch nach dem Treffen mit Nogare wurde Papa krank und starb am 11. Oktober. Die Vorherrschaftsansprüche der Päpste scheiterten im Kampf mit der königlichen Macht. Eine wichtige Folge des Kampfes zwischen Philipp IV. und Bonifatius VII. war, dass der König erstmals einen Präzedenzfall für die Berufung päpstlicher Entscheidungen beim Ökumenischen Konzil schuf, das somit über dem Papst stand. Diese Idee sollte später sowohl während der Spaltung der Westkirche als auch einige Jahrhunderte später eine wichtige Rolle spielen. Im Jahr 1304 unternahm der König an der Spitze einer 60.000 Mann starken Armee einen neuen Feldzug in Flandern. Am Ende gelang es ihm, 1305 Flandern den Frieden aufzuzwingen, und zwar nicht so sehr durch militärische Aktionen, sondern durch geschickte diplomatische Manöver. Die Flamen behielten alle ihre Rechte und Privilegien. Allerdings mussten sie eine hohe Entschädigung zahlen. Als Pfand für die Zahlung des Lösegelds nahm der König Ländereien am rechten Ufer der Leie mit den Städten Lille, Douai, Bethune und Orsha. Philip sollte sie nach Erhalt des Geldes zurückgeben, doch er verstieß heimtückisch gegen die Vereinbarung und überließ sie für immer Frankreich. Nach dem nur wenige Monate dauernden Pontifikat Benedikts XI. wählten die Kardinäle im Juni 1305 den Erzbischof von Bordeaux, Bertrand de Gault, der als Papst Clemens V. in die Geschichte einging. Zum neuen Papst, dem eine dauerhafte Residenz gewährt wurde Die Stadt Avignon berief zunächst mehrere Franzosen in das Kardinalskollegium und sicherte so die künftige Wahl „französischer“ Päpste. Philipps moralischer Triumph wurde in der Bulle von Clemens V. verewigt, in der Philipps „Eifer“ im Streit mit Bonifatius als „gut und gerecht“ und der König selbst als „Verfechter der Religion“ anerkannt wurde. Bis zu seinem Tod blieb Clemens ein gehorsamer Testamentsvollstrecker des französischen Königs. Unterdessen zeigte die französische Diplomatie außerordentliche Aktivität und hegte aggressive Pläne. Unter Philipp IV. wurde die Politik der Beschlagnahmung verschiedener zum Reich gehörender Grenzbesitztümer zur Tradition. Im Grenzstreifen zwischen Frankreich und Deutschland gab es viele große und kleine feudale Fürstentümer, die nur formal vom Reich abhängig waren und zwischen denen es endlose Territorialstreitigkeiten gab. Sobald einer von ihnen sich in diesen Auseinandersetzungen auf das Reich verließ, wandte sich der andere sofort hilfesuchend an Frankreich. Die Herrscher dieser Fürstentümer gingen Bündnisse ein. Die Taktik der königlichen Diplomatie in diesen Gebieten bestand immer darin, eine eigene frankophile Partei, „vertrauenswürdige“ Leute zu haben und, wenn die Gelegenheit günstig war, diesen oder jenen Besitz zu annektieren. Der französische Einfluss breitete sich auf alle umstrittenen Gebiete der deutsch-französischen Grenze aus, auf die lothringischen Besitztümer, auf Lyon, das 1312 schließlich die Souveränität des französischen Königs anerkannte, auf Valenciennes, dessen Stadtbewohner gegen ihren Grafen rebellierten und forderten, „zu gehören“. Französisches Königreich.“ Während der Regierungszeit Kaiser Albrechts von Österreich soll es bei seinem Treffen mit Philipp IV. in Vaucouleurs zu geheimen Verhandlungen gekommen sein. Philipp verpflichtete sich heimlich, Albrecht dabei zu helfen, die Kaiserkrone im Erbbesitz des Hauses Habsburg zu behalten, wofür Albrecht im Gegenzug weite Gebiete an Philipp IV. abtreten musste – das linke Rheinufer und das Rhonetal. Was auch immer der tatsächliche Inhalt sein mochte Die Geheimverhandlungen in Vaucouleurs lassen keinen Zweifel daran, dass das linke Rheinufer und das Programm umfassender Gebietseroberungen bereits im Fokus der französischen Diplomatie standen. Mit dem Tod von Albrecht von Österreich, der 1308 getötet wurde, wurden die Pläne der französischen Diplomatie völlig grandios. Es gibt einen bekannten Satz, den viele Historiker Philipp zuschreiben: „Wir, die wir unseren Besitz abrunden wollen ...“ Zu diesem Zweck beschloss Philipp, seinen Bruder Karl von Valois zu erheben, der eher für Schlachten und Schlachten geschaffen war Turniere als für die Politik, auf den Kaiserthron. Einer der Vertrauten König Philipps IV., der unermüdliche Legalist Pierre Dubois, überreichte dem König eine vertrauliche Notiz. Er empfahl, Philipp selbst mit Hilfe von Clemens V. unter Umgehung seines Bruders Karl von Valois zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zu krönen. Die Verwaltung eines solchen Reiches (fast ganz Westeuropas) erforderte eine andere Person und keinen „Turnier-Stammgast“, der von ritterlicher Romantik durchdrungen war, schrieb der Legalist. Dubois träumte davon, das linke Rheinufer oder die Provence, Savoyen, an Frankreich zu annektieren und die Rechte zu erlangen, die das Reich in der Lombardei und in Venedig hatte. Durch dynastische Bindungen würde der französische König Italien und Spanien kontrollieren. „Dann“, schließt Dubois seine geliebten Gedanken ab, „würde Philipp die europäische Politik von Frankreich aus leiten ... Er würde den inneren Frieden in Deutschland und Italien wiederherstellen und könnte danach alle westlichen Nationen unter seinem Banner zur Eroberung Palästinas führen.“ Allerdings war die Aussicht auf eine weltweite kapetische Monarchie eine zu große Gefahr für alle ihre Nachbarn. Dagegen griffen alle zu den Waffen, allen voran die deutschen Fürsten und sogar Papst Clemens V. Durch ihre gemeinsamen Anstrengungen scheiterten die Pläne der französischen Diplomatie und nicht Valois, sondern Heinrich von Luxemburg wurde auf den deutschen Thron erhoben. Trotz der raffinierten Manöver Philipps IV. und seiner Legalisten, trotz Bestechung und Einschüchterung gelang es ihm also nicht, das Reich zum zweiten Mal in Besitz zu nehmen. Der dritte Versuch wurde durch Philipps Tod im Jahr 1314 vereitelt. Wenn man über Philipp IV. spricht, kann man nicht umhin, den sogenannten Prozess des Templerordens zu erwähnen. Dieser Orden war sehr reich, betreibt Wucher und gewährte dem französischen König und anderen hochrangigen Beamten mehr als einmal Kredite zu hohen Zinssätzen. Abt John Trittenheim stellt kategorisch fest, dass der Templerorden der reichste Orden war und nicht nur riesige Geldbeträge, sondern auch über ganz Europa verstreute Ländereien, Städte und Burgen besaß. Auf Befehl Philipps wurden 1307 alle Mitglieder des Templerordens in ganz Frankreich am selben Tag verhaftet. Ihnen wurde Kreuzschändung, Götzendienst und Sodomie vorgeworfen. Gleichzeitig ist es keineswegs ausgeschlossen, dass Philipp vieles von dem glaubte, was im Volk über die Templer gesagt wurde (ihnen wurden Säkularismus und Stolz, dunkle Rituale und vieles mehr vorgeworfen). Bei der Entscheidung des Königs spielte jedoch das Geld die größte Rolle. Einigen Berichten zufolge schuldete Philipp der Schöne diesem reichen Orden einen hohen Betrag. Clemens V. berief im Oktober 1311 einen allgemeinen Kirchenrat in der Stadt Vienne ein, wo auf Druck des französischen Hofes beschlossen wurde, den Templerorden abzuschaffen und seinen Besitz zu beschlagnahmen, was im April 1312 geschah. Ursprünglich sollten die beschlagnahmten Gelder an einen anderen Orden übertragen und für die Organisation neuer Kreuzzüge verwendet werden, doch der Großteil dieses riesigen Vermögens ging an Philipp selbst und andere Monarchen, die ebenfalls den Templerorden in ihren Territorien verboten und von ihrem Reichtum profitierten. Am Ende der Herrschaft Philipps IV. war Frankreich die mächtigste Macht Europas: Die päpstliche Macht wurde besiegt, das Deutsche Reich verlor jeglichen Einfluss, seine Fürsten standen teils im Sold Philipps, teils im Sold des englischen Königs . Philipp starb am 29. November 1314 in Fontainebleau.
Planen
Einführung
1 Eigenschaften
2 Rechtsstreit mit dem englischen König
3 Flandernkrieg
4 Streit mit Papa. Avignon, Gefangenschaft der Päpste
5 Niederlage des Templerordens
6 Finanzielle Aktivitäten
7 Tod
8 Familie und Kinder
Einführung
Philipp IV. der Schöne (fr. Philipp IV. der Bel, 1268, Fontainebleau - 29. November 1314, Fontainebleau) - französischer König (1285 - 1314), Sohn von Philipp III. dem Kühnen, aus der kapetischen Dynastie.
1. Eigenschaften
Seine Herrschaft spielte eine wichtige Rolle beim Niedergang der politischen Macht der Feudalherren und der Stärkung des Monarchismus in Frankreich. Er führte die Arbeit seines Vaters und Großvaters fort, aber die Bedingungen seiner Zeit, die Besonderheiten seines Charakters und die Eigenschaften der Berater und Assistenten um ihn herum betonten und verstärkten die Färbung von Gewalt und Grausamkeit, die in früheren Regierungszeiten nicht völlig fehlte .
2. Rechtsstreit mit dem englischen König
Eduard I. ist eine Hommage an König Philipp
Philipps Berater, die im Geiste der Traditionen des römischen Rechts erzogen wurden, versuchten stets, eine „legitime“ Grundlage für die Forderungen und Schikanen des Königs zu finden und gestalteten die wichtigsten diplomatischen Auseinandersetzungen in Form von Gerichtsverfahren. Philipps gesamte Regierungszeit war voller Streitereien, „Prozesse“ und diplomatischer Streitereien der schamlosesten Art.
Nachdem Philipp beispielsweise den Besitz von Guienne für den englischen König Eduard I. bestätigt hatte, rief er ihn nach einigen Streitereien vor Gericht, da er wusste, dass Eduard, der sich zu dieser Zeit mit den Schotten im Krieg befand, nicht erscheinen konnte. Eduard, der einen Krieg mit Philipp befürchtete, sandte eine Gesandtschaft zu ihm und erlaubte ihm, Guienne vierzig Tage lang zu besetzen. Philipp übernahm das Herzogtum und wollte es den Bedingungen entsprechend nicht verlassen. Es begannen diplomatische Verhandlungen, die zum Ausbruch von Feindseligkeiten führten; aber am Ende gab Philipp Guienne, damit der englische König ihm dennoch den Eid leisten und sich als seinen Vasallen anerkennen konnte. Dies geschah in den Jahren 1295-1299, und die Militäraktionen gegen England endeten nur, weil die Verbündeten der Engländer, die Flamen, von unabhängigen Interessen geleitet, energisch begannen, den Norden des Königreichs zu stören.
3. Flandernkrieg
Philipp IV. gelang es, die flämische Stadtbevölkerung für sich zu gewinnen; Der Graf von Flandern wurde vor der einfallenden französischen Armee fast allein gelassen und gefangen genommen, und Flandern wurde an Frankreich angegliedert. Im selben Jahr (1301) kam es zu Unruhen unter den eroberten Flamen, die vom französischen Gouverneur Chatillon und anderen Schützlingen Philipps stark unterdrückt wurden. Der Aufstand breitete sich über ganz Flandern aus und in der Schlacht von Kortrijk (1302) wurden die Franzosen vollständig besiegt. Danach dauerte der Krieg mehr als zwei Jahre mit unterschiedlichem Erfolg; Erst 1305 mussten die Flamen einen großen Teil ihres Territoriums an Philipp abtreten, die Vasallenabhängigkeit der verbleibenden Ländereien von ihm anerkennen, etwa 3.000 Bürger zur Hinrichtung übergeben, Festungen zerstören usw. Der Krieg mit Flandern zog sich in die Länge. vor allem, weil die Aufmerksamkeit Philipps des Schönen in diesen Jahren durch den Kampf mit Papst Bonifatius VIII. abgelenkt wurde.
4. Streite mit Papa. Avignon, Gefangenschaft der Päpste
Münze mit der Darstellung Philipps IV. des Schönen (1286).
In den ersten Jahren seines Pontifikats war Bonifatius dem französischen König recht freundlich gesinnt, doch schon bald zerstritten sie sich aus rein finanziellen Gründen. Im Herbst 1296 erließ Bonifatius die Bulle clericis laicos, die dem Klerus kategorisch untersagte, Steuern an die Laien zu zahlen, und den Laien, solche Zahlungen vom Klerus ohne besondere Genehmigung der Römischen Kurie zu verlangen. Philipp, der immer Geld brauchte, sah in dieser Bulle eine Schädigung seiner Steuerinteressen und einen direkten Widerstand gegen die Doktrin, die sich am Pariser Hof durchzusetzen begann und deren Hauptvertreter, Guillaume Nogaret, predigte, dass der Klerus zur Hilfe verpflichtet sei die Bedürfnisse ihres Landes mit Geld zu decken.
Als Reaktion auf die Bulle verbot Philipp der Schöne den Export von Gold und Silber aus Frankreich; Papa wurde dadurch einer bedeutenden Einnahmequelle beraubt. Die Umstände waren für den französischen König günstig – und der Papst gab nach: Er erließ eine neue Bulle, die die vorherige annullierte, und sprach sogar, als Zeichen besonderer Gunst, den verstorbenen Großvater des Königs, Ludwig IX., Heilig.
Diese Nachgiebigkeit führte jedoch nicht zu einem dauerhaften Frieden mit Philipp, der einen weiteren Streit wünschte: Er wurde vom Reichtum der französischen Kirche in Versuchung geführt. Die den König umgebenden Juristen, insbesondere Nogaret und Pierre Dubois, rieten dem König, ganze Kategorien von Strafsachen der Zuständigkeit der Kirchenjustiz zu entziehen. Im Jahr 1300 wurden die Beziehungen zwischen Rom und Frankreich äußerst angespannt. Der von Bonifatius als Sonderlegat an Philipp entsandte Bischof von Pamiers Bernard Sesseti verhielt sich äußerst unverschämt: Er war ein Vertreter jener Partei im Languedoc, die die Nordfranzosen besonders hasste. Der König erhob Klage gegen ihn und forderte den Papst auf, ihn seines Amtes zu entheben; Dem Bischof wurden nicht nur Beleidigung des Königs, sondern auch Verrat und andere Verbrechen vorgeworfen.
Der Papst antwortete dem König (im Dezember 1301), indem er ihn des Eingriffs in die geistliche Autorität beschuldigte und ihn aufforderte, vor seinem Hof zu erscheinen. Gleichzeitig sandte er eine Bulle (Ausculta fili) an den König, in der er die Fülle der päpstlichen Macht und ihre Überlegenheit über alle (ausnahmslos) weltlichen Macht betonte. Der König (der Legende nach hatte er zuvor die Bulle verbrannt) berief im April 1302 die Generalstände ein (die ersten in der französischen Geschichte). Die Adligen und Vertreter der Städte drückten ihr bedingungsloses Mitgefühl für die königliche Politik aus, und der Klerus beschloss, den Papst zu bitten, ihnen zu erlauben, nicht nach Rom zu gehen, wo er sie zu dem gegen Philipp vorbereiteten Konzil berief. Bonifatius stimmte nicht zu, aber der Klerus reiste trotzdem nicht nach Rom, weil der König ihnen dies kategorisch verbot.
Auf dem Konzil, das im Herbst 1302 stattfand, bekräftigte Bonifatius in der Bulle Unam sanctam erneut seine Meinung über die Vorherrschaft der geistlichen Macht über die weltliche Macht, des „geistigen Schwertes“ über die „weltliche“. Im Jahr 1303 entließ Bonifatius einen Teil des Philipp unterworfenen Landes vom Vasalleneid, und der König berief als Reaktion darauf ein Treffen hochrangiger Geistlicher und weltlicher Barone ein, vor dem Nogaret Bonifatius aller möglichen Gräueltaten beschuldigte.
Bald darauf reiste Nogaret mit einem kleinen Gefolge nach Italien, um den Papst zu verhaften, der dort Todfeinde hatte, was die Aufgabe des französischen Agenten erheblich erleichterte. Papa reiste nach Anagni, ohne zu wissen, dass die Bewohner dieser Stadt bereit waren, ihn zu verraten. Nogare und seine Gefährten betraten frei die Stadt, betraten den Palast und verhielten sich hier mit größter Unhöflichkeit, fast sogar mit Gewalt (es gibt sogar eine Version einer Ohrfeige für den Papst). Zwei Tage später änderte sich die Stimmung der Menschen in Anagna und sie ließen den Papst frei. Wenige Tage später starb Bonifatius VIII. und zehn Monate später starb auch sein Nachfolger Bonifatius IX. Da dieser Tod für den französischen König zu einem sehr günstigen Zeitpunkt kam, wurde er Gerüchten zufolge auf Gift zurückzuführen.
Der neue (französische) Papst Clemens V., der 1304 (nach einem neunmonatigen Wahlkampf) gewählt wurde, verlegte seinen Wohnsitz nach Avignon, das nicht an der Macht war, aber unter dem direkten Einfluss der französischen Regierung stand. Nachdem er dem Papsttum ein Ende gesetzt und es zu einem Instrument in seinen Händen gemacht hatte, begann Philipp, seinen geliebten Traum zu verwirklichen.
5. Niederlage des Templerordens
Münze von Philipp IV. dem Schönen (1306).
Der Beginn dieser Konfrontation, die, wie Zeitgenossen bemerkten, viele Menschenleben forderte, wurde durch Zufall gelegt. König Philipp dem Schönen wurde mitgeteilt, dass ein gewisser Mann, der auf sein Todesurteil wartete, seine Audienz suchte. Dieser Mann behauptete, er verfüge über Informationen von nationaler Bedeutung, könne diese jedoch nur dem König persönlich mitteilen. Diese Person wurde schließlich eingeliefert. Er sagte, dass er, als er zusammen mit einem bestimmten Verurteilten in der Todeszelle saß, Folgendes aus seinem Geständnis gehört habe (zu dieser Zeit gab es in Europa eine gerichtliche Maßnahme, die es Menschen, die besonders schwere Verbrechen begangen hatten, nicht erlaubte, die kirchliche Kommunion zu empfangen, so z Kriminelle beichteten sich vor der Hinrichtung oft gegenseitig ihre Sünden. Dieser Jemand war Mitglied des Templerordens und sprach über die grandiose Verschwörung dieses Ordens gegen säkulare Monarchien. Der Orden verfügte über enorme finanzielle Mittel und erlangte mit Hilfe von Krediten sowie Bestechungsgeldern und Bestechungsgeldern nach und nach die Kontrolle über fast die Hälfte des Adels und der Adelsfamilien Frankreichs, Italiens und Spaniens. Dieser Mann behauptete auch, dass dieser ursprünglich als christlicher Orden gegründete Orden das Christentum schon vor langer Zeit aufgegeben habe. Bei ihren Treffen praktizierten Ordensmitglieder (einschließlich des Zeugen selbst) Spiritualismus und Wahrsagerei. Mitglieder des Ordens spuckten bei ihrem Beitritt auf das Kreuz und verzichteten lautstark auf die Macht der Kirche über sich selbst. Nachdem er dem Informanten zugehört hatte, befahl Philip, ihn zu begnadigen und „ihn mit einer Brieftasche voller Münzen für wertvolle Informationen zu belohnen“.
Nachdem Philipp mit Rom kommuniziert hatte, entwickelte er heimlich, sogar vor denen, die ihm am nächsten standen, und mehreren ihm vertrauten Personen eine Operation, um Ordensmitglieder zu verhaften. Es sollte gesagt werden, dass der Krieg mit dem Orden viele Jahre dauerte und viele Menschenleben forderte. Die gesamte Bevölkerung stand dem Orden ablehnend gegenüber, die Güter und Burgen seiner Mitglieder genossen traditionell einen schlechten Ruf. Beispielsweise beschuldigten Bauern in den südlichen Provinzen die Templer, Mädchen und Jungen gestohlen zu haben, um an Orgien teilzunehmen, die angeblich von den Rittern des Ordens veranstaltet wurden.
Philipp IV. der Schöne (Französische Nationalbibliothek).
In zahlreichen Prozessen, die nach der Festnahme stattfanden, seien „Details“ ans Licht gekommen, die die öffentliche Meinung in Europa erschütterten. Neben offenem Ungehorsam der Ordensoberhäupter und vor allem ihres Meisters Jacques de Molay gegenüber der Staatsgewalt in der Person des Königs kam es zu zahlreichen Fällen von Steuerhinterziehung (königliche Steuern), Finanzbetrug mit Immobilien (hauptsächlich mit Land in den Südprovinzen), Wucher (der damals verboten war), Tatsachen der Bestechung, spekulative Inflation der Lebensmittelpreise in mageren Jahren, Kauf von gestohlenen Waren und viele andere Verbrechen, den Großteil der „Beweise“. “, der von königlichen Legisten erfunden wurde.
Der Orden wurde aufgelöst und verboten, Eigentum wurde beschlagnahmt und verstaatlicht. Viele Forscher glauben jedoch, dass nicht alle Finanzen der Templer aufgespürt und beschlagnahmt wurden. Es wird angenommen, dass ein erheblicher Teil der Gelder außerhalb Frankreichs (hauptsächlich nach Spanien und Italien) evakuiert wurde. Angesichts der kurzen Zeitspanne, in der es gelang, die Ordnung in Spanien wiederherzustellen, kann diese Version als nicht ohne Plausibilität angesehen werden.
Aus historischer Sicht ist die Position Roms in dieser Konfrontation sehr interessant. Der Papst beharrte eher schwach auf dem Vorwurf (angesichts der Schwere der Vergehen aus Sicht des katholischen Dogmas), dass sich viele Templer in den Provinzen, in denen der Papst oder der italienische Adel großen Einfluss hatten, der Verantwortung entzogen hätten. Forscher, die sich mit diesem Thema befassen, glauben zu Recht, dass der italienische Adel den Templern riesige Summen schuldete, und es ist möglich, dass der Papst selbst ihr Kreditnehmer war.
6. Finanzielle Aktivitäten
Der Hauptnerv aller Aktivitäten Philipps war der ständige Wunsch, die leere königliche Schatzkammer zu füllen. Zu diesem Zweck wurden mehrmals die Generalstände und gesondert die Vertreter der Städte einberufen; Zu diesem Zweck wurden verschiedene Grundstücke verkauft und verpachtet, Zwangsanleihen von Städten aufgenommen, hohe Steuern sowohl auf Güter erhoben (so wurde 1286 die Gabel eingeführt, die bis 1790 existierte), als auch auf Güter minderwertige Münzen geprägt, und die Bevölkerung, insbesondere die nichtkaufmännische Bevölkerung, erlitt schwere Verluste.
Im Jahr 1306 musste Philipp sogar vorübergehend aus Paris fliehen, bis die Wut der Bevölkerung über die Folgen seiner 1304 erlassenen Verordnung über Höchstpreise nachließ.
Die Verwaltung war stark zentralisiert; Dies machte sich besonders in den Provinzen bemerkbar, in denen feudale Traditionen noch stark ausgeprägt waren. Die Rechte der Feudalherren wurden erheblich eingeschränkt (zum Beispiel in Sachen Münzprägung). Der König wurde nicht so sehr wegen seiner Natur geliebt, die zu jedem Verbrechen bereit war, sondern wegen seiner zu gierigen Finanzpolitik.
Philipps äußerst aktive Außenpolitik gegenüber England, Deutschland, Savoyen und allen Grenzbesitztümern, die manchmal zur Aufrundung der französischen Besitztümer führte, war der einzige Aspekt der Regierungszeit des Königs, der sowohl seinen Zeitgenossen als auch den unmittelbaren Generationen gefiel.
Posthumer Grabstein von Philipp IV. dem Schönen.
Philipp IV. der Schöne starb am 29. November 1314 im Alter von 47 Jahren in seinem Geburtsort Fontainebleau, wahrscheinlich war die Todesursache ein schwerer Schlaganfall. Viele brachten seinen Tod mit dem Fluch des Großmeisters des Templerordens, Jacques de Molay, in Verbindung, der vor seiner Hinrichtung am 18. März 1314 in Paris den Tod des Königs, seines Beraters Guillaume de Nogaret, in weniger als einem Jahr vorhersagte und Papst Clemens V. – alle drei starben tatsächlich im selben Jahr. Er wurde in der Basilika der Abtei Saint-Denis bei Paris beigesetzt. Sein Nachfolger wurde sein Sohn Ludwig X. der Mürrische
8. Familie und Kinder
Er war ab dem 16. August 1284 mit Johanna I. (11. Januar 1272 – 4. April 1305), Königin von Navarra und ab 1274 Gräfin von Champagne, verheiratet. Diese Ehe ermöglichte die Angliederung der Champagne an die königliche Domäne und führte auch zur ersten Vereinigung Frankreichs und Navarras im Rahmen der Personalunion (bis 1328).
In dieser Ehe geboren:
· Ludwig X(4. Oktober 1289 – 5. Juni 1316), König von Frankreich (ab 1314) und Navarra (ab 1307)
· Blanka (1290-1294)
· Isabel(1292–27. August 1358), seit dem 25. Januar 1308 Ehefrau des englischen Königs Eduard II. und Mutter von Eduard III. Von Isabella stammen die Ansprüche der Plantagenets auf die französische Krone, die als Vorwand für den Beginn des Hundertjährigen Krieges dienten.
Über das Privatleben des Königs nach dem Tod seiner Frau sowie über die Anwesenheit von Kindern anderer Frauen sind keine Informationen erhalten.
Literatur
· Boutaric, La France sous Philippe le Bel, S. 1861
· Jolly, Philippe le Bel, P., 1869
· B. Zeller, Philippe le Bel et ses trois fils, P., 1885
· Maurice Druon „Der Eiserne König“. Das erste Buch der „Cursed Kings“-Reihe (Der Eiserne König. Der Gefangene von Chateau-Gaillard. Übersetzt aus dem Französischen. M., 1981)
Beim Verfassen dieses Artikels wurde Material aus dem Enzyklopädischen Wörterbuch von Brockhaus und Efron (1890-1907) verwendet.
Nicht umsonst erhielt Philipp IV. seinen Spitznamen „Der Schöne“. Regelmäßige Gesichtszüge, große, bewegungslose Augen, welliges dunkles Haar. Er war wie eine prächtige Skulptur, bewegungslos und betörend unzugänglich in seiner majestätischen Distanziertheit. Melancholie, ein ewiger Abdruck in seinem Gesicht, machte ihn zu einer mysteriösen und einzigartigen Person in der Geschichte ...
Philipp war der zweite Sohn von König Philipp III. und Isabella von Aragon. Schon damals war in den engelhaften Gesichtszügen des Babys außergewöhnliche Schönheit zu erkennen, und es ist unwahrscheinlich, dass der glückliche Vater beim Anblick seines Nachwuchses sich vorstellen konnte, dass er der letzte große Vertreter der kapetischen Königsfamilie werden würde.
Philipp III. kann nicht als erfolgreicher Monarch bezeichnet werden. Die Feudalherren gehorchten ihm nicht wirklich, die Schatzkammer war leer und die päpstlichen Legaten diktierten ihr Testament.
Und als der allmächtige Papst dem französischen König befahl, einen Feldzug nach Aragon zu führen, um den aragonesischen König dafür zu bestrafen, dass er Sizilien dem Günstling des Papstes (Karl von Anjou) weggenommen hatte, konnte Philipp nicht widerstehen und die französische Armee machte sich auf den Weg zum Feldzug. Das Schicksal war nicht auf Philipps Seite: Die Franzosen erlitten eine schwere Niederlage und der König selbst starb auf dem Rückweg.
Philipp IV. der Schöne
Sein siebzehnjähriger Sohn, der an der Seite seines Vaters kämpfte, lernte aus diesem beklagenswerten Unternehmen eine sehr wichtige Lektion – eine anhaltende Zurückhaltung, den Interessen anderer, auch der päpstlichen, zu dienen. Im Jahr 1285 fand die Krönung Philipps IV. statt und seine Ära begann, die man in jeder Hinsicht als „neu“ bezeichnen könnte.
Zunächst musste sich der junge König mit dem Erbe seines Vaters auseinandersetzen und das aragonesische Problem lösen. Er löste es auf die für Frankreich vorteilhafteste Weise: Er stellte die Militäroperationen trotz der dringenden Einwände des Heiligen Stuhls vollständig ein.
Ein echter Schock für das mittelalterliche Europa war die Weigerung eines völlig unerfahrenen Monarchen, die Dienste der hochrangigen Berater seines Vaters in Anspruch zu nehmen. Stattdessen richtete er einen Königlichen Rat ein, dessen Mitgliedschaft durch besondere Verdienste und nicht durch adelige Herkunft gesichert war. Für die feudale Gesellschaft war dies eine echte Revolution.
So gelangten nicht adlige, sondern gebildete Menschen an die Macht. Wegen ihrer Kenntnis der Gesetze wurden sie Legalisten genannt und waren sehr verhasst. Drei seiner engen Mitarbeiter spielten am Hofe Philipps des Schönen eine besondere Rolle: Kanzler Pierre Flotte, Siegelhüter Guillaume Nogaret und Koadjutor Enguerrand Marigny. Vom König selbst an die Macht gebracht, waren sie ihm gegenüber äußerst loyal und bestimmten den Kurs der gesamten Staatspolitik.
Und die gesamte Politik Philipps IV. bestand darin, zwei Probleme zu lösen: wie man neue Ländereien dem Staat angliedert und wo man das Geld dafür bekommt.
Johanna I. von Navarra, Prinzessin des Hauses Champagne, regierende Königin von Navarra seit 1274, Tochter und Erbin Heinrichs I. von Navarra und Königin von Frankreich seit 1285 – Ehefrau von Philipp IV. dem Schönen.
Auch Philipps Heirat war dem großen Ziel der Expansion Frankreichs untergeordnet: Er heiratete Johanna I., Königin von Navarra und Gräfin der Champagne. Diese Heirat gab ihm die Möglichkeit, Champagner zu seinem Besitz hinzuzufügen, und führte auch zur ersten Vereinigung Frankreichs und Navarras.
Aber das war nicht die Grenze der Träume des Königs. Philip weigerte sich, päpstlichen Interessen nachzugeben und konzentrierte seine Aufmerksamkeit auf englische Angelegenheiten. Der Stein des Anstoßes war der Wunsch des Monarchen, Flandern zu erobern.
Nachdem beide Seiten Eduard I. vor den Hof des Pariser Parlaments gerufen und seine Weigerung als Vorwand für einen Krieg genutzt hatten, begannen sie mit großer Freude mit militärischen Operationen, nachdem sie Verbündete gewonnen hatten. Papst Bonifatius VIII., der davon erfuhr, rief beide Monarchen zur Versöhnung auf. Und beide ignorierten diesen Anruf.
Die Sache wurde dadurch noch komplizierter, dass Philipp dringend Geld brauchte, um den Krieg zu führen, und deshalb den Export von Gold und Silber aus Frankreich nach Rom verbot. Der Papst verlor eine seiner Einnahmequellen und das Verhältnis zwischen Philipp und Bonifatius wurde dadurch nicht wärmer.
Philipp IV. der Schöne – König von Frankreich ab 1285, König von Navarra 1284-1305, Sohn von Philipp III. dem Kühnen, aus der kapetischen Dynastie.
Der Papst drohte, Philipp zu exkommunizieren. Und dann griffen die Legalisten zu den Waffen, das heißt zu ihren Federn, und brachten eine ganze Reihe von Anschuldigungen gegen den Papst vor, sowohl wegen Intrigen gegen Frankreich als auch wegen Häresie.
Die Agitation trug Früchte: Die Franzosen hatten keine Angst mehr vor dem Zorn des Papstes, und Nogaret, der nach Italien ging, heckte eine umfangreiche Verschwörung gegen den Papst aus. Bald starb der schon recht betagte Bonifatius VIII. und der Schützling Frankreichs, Clemens V., saß auf dem päpstlichen Thron. Der päpstliche Streit wurde beigelegt.
Philip hatte immer Geldmangel. Die von ihm verfolgte Einigungs- und Annexionspolitik erforderte große Kosten. Das erste Opfer der finanziellen Schwierigkeiten des Königs war die Münze. Sein Gewicht wurde deutlich verringert und die Produktion gesteigert, was zu einer erhöhten Inflation führte. Der zweite Punkt des Finanzprogramms des Königs war die Besteuerung. Die Steuern stiegen ständig, was zu Unruhen in der Bevölkerung führte. Und schließlich – die Sache mit den Templern.
Der Templerorden entstand zu Beginn des 12. Jahrhunderts in Jerusalem. Er stellte sich vor, Ritter zu sein, die das Heilige Grab bewachten. Darüber hinaus schützten die Tempelritter ihr eigenes, recht beträchtliches Vermögen und Geld derer, die ihnen vertrauten. Die muslimische Offensive zwang die Templer, das Heilige Land zu verlassen, und im Laufe der Zeit wurde ihre Hauptaufgabe finanzieller Natur. Sie wurden praktisch zu einer Bank, die Geld speicherte und investierte.
Einer der Schuldner des Ordens war Philipp der Schöne selbst. Wie das Leben gezeigt hat, wollte der König seine Schulden wirklich nicht zurückzahlen, und deshalb wurden 1307 mit stillschweigender Zustimmung des Papstes alle Templer in ganz Frankreich am selben Tag verhaftet. Der Prozess gegen den Befehl war eindeutig eine Schönfärberei, die Anschuldigungen waren weit hergeholt, die Verhöre wurden unter Anwendung von Folter durchgeführt und der Fall endete in flammenden Bränden in ganz Frankreich. Auch der Großmeister des Ordens, Jean Molay, wurde verbrannt.
Jacques de Molay ist der dreiundzwanzigste und letzte Meister des Tempelritters.
Wie weit verbreitete Gerüchte bezeugten, verfluchte der Meister vor der Hinrichtung Clemens V. und Philipp IV. und sagte dem ersten den Tod in vierzig Tagen und dem zweiten in zwölf Monaten voraus. Die Vorhersage wurde auf wundersame Weise wahr.
Der Papst starb dreiunddreißig Tage nach der Hinrichtung Molays an Ruhr, und der König erkrankte daraufhin an einer seltsamen Krankheit und starb am 29. November 1314. Der Fluch traf auch Philipps Nachkommen. Seine drei Söhne – die „verdammten Könige“ – hinterließen laut dem Fluch der Templer keine Nachkommen auf dem Thron, und die Linie der Kapetinger wurde bald unterbrochen.
Philipp der Schöne ist in der Geschichte eine mysteriöse und umstrittene Figur geblieben. Manche nennen ihn einen großen Reformer, andere nennen ihn einen grausamen Despoten, der unter den Einfluss seiner Berater geraten sei. Die Ergebnisse seiner Herrschaft waren enttäuschend: Die Machtvertikale wurde nie vollständig geformt, aber am Ende gerieten die Finanzen ins Wanken.
Die Zickzacklinien seiner Politik sowie seine häufigen Stimmungsschwankungen und die Art, wie er erstarrt, ohne mit der Wimper zu blinzeln, werden von vielen modernen Forschern mit der manisch-depressiven Störung seines Bewusstseins in Verbindung gebracht.
Augenzeugen zufolge war er zu bestimmten Zeiten fröhlich, gesprächig und scherzte sogar. Aber er wurde bald düster, zurückgezogen, schweigsam und gleichgültig grausam.
Philipp IV. der Schöne
Nun ja, die Mächtigen dieser Welt haben auch Schwächen. Und dennoch machte König Philipp der Schöne während seiner Herrschaft Frankreich zum mächtigsten Land der Welt und leitete eine neue Ära in der Geschichte dieses Staates ein.
Der französische König Philipp IV., der aufgrund seines ungewöhnlich attraktiven Aussehens den Spitznamen „Gutaussehend“ erhielt, hinterließ bei den heutigen Zeitgenossen eine widersprüchliche Meinung über sich selbst als Herrscher und Mensch. Aus historischen Quellen, die bis in unsere Zeit erhalten sind, geht hervor, dass er eine für einen Herrscher ungewöhnliche Sanftmut besaß, auch denen vertraute, die es nicht wert waren, fromm war und keinen einzigen Gottesdienst versäumte. Doch im Gegensatz zu solchen Informationen sprach die von ihm verfolgte Staatspolitik beredt vom unbeugsamen Willen, der Charakterstärke und der Entschlossenheit des Königs. Eine wichtige Rolle bei der Lösung staatlicher Probleme spielten die Angehörigen Philipps des Schönen – der Siegelhüter Guillaume Nogaret, der Koadjutor Frankreichs Enguerrand Marigny und der Kanzler Pierre Flotte. Im Alter von siebzehn Jahren bestieg Philipp IV. den Thron und begann seine Herrschaft mit der Lösung staatlicher Fragen im Zusammenhang mit Sizilien und Aragonien.Seine Eltern waren Philipp III. und Isabella von Aragon. Der Geburtsort des zukünftigen Königs war Fontainebleau, wo er 1268 geboren wurde. Während seiner Herrschaft gehörte Sizilien weiterhin zu Aragon. Sein Verhältnis zum englischen König Eduard I., der ein Vasall Philipps IV. war, war konfliktreich. Eine solch schwierige Situation eskalierte oft zu Feindseligkeiten zwischen Staaten, wobei jede der Kriegsparteien nach Verbündeten suchte. Schottland stellte sich auf die Seite Frankreichs und zwang ihn mit seinen militärischen Aktionen gegen Eduard I. 1297 zum Abschluss eines Waffenstillstands mit Philipp IV. Vor dem Hintergrund der Militäraktionen des französischen Herrschers in Spanien und Italien verschlechterten sich seine Beziehungen zu Papst Bonifatius VIII., der zuvor in diesen Ländern Anhänger der Politik Philipps IV. gewesen war, stark. Die ersten Konflikte begannen im Jahr 1296, als der französische König den Export von Gold und Silber ins Ausland verbot. Diese Aktion war eine Reaktion auf die Entscheidung des Papstes, den Laien den Erhalt von Subventionen durch den Klerus zu verbieten. Da er einen Teil seines Einkommens verloren hat, hebt Papa seine Entscheidung auf. Als Reaktion darauf erlaubt der König, dass die Gelder, die dem Papst vom französischen Klerus zuflossen, aus dem Land exportiert werden.Die ständige Feindschaft zwischen dem König und Bonifatius führte dazu, dass der Papst im Frühjahr 1303 Philipp den Schönen aus der Kirche exkommunizierte und 7 kircheneigene Provinzen von der Vasallenschaft befreite. Als Reaktion auf diese Aktionen erklärte Philipp der Schöne Bonifatius zum falschen Papst und Ketzer. Anschließend schickte er Nogare mit einer großen Geldsumme nach Italien, um eine Verschwörung gegen Bonifatius zu organisieren. Zu dieser Zeit befand sich der Papst selbst in Anagni und bereitete sich darauf vor, den König öffentlich zu verfluchen. Am Tag zuvor wurde er von Nogare gefangen genommen und verbrachte drei Tage in den Händen der Verschwörer. Nach der Freilassung von Bonifatius durch die Einwohner von Anagna wurde der Geist des Papstes geschädigt und im Oktober 1303 starb er. Im Jahr 1307 begann der König mit seinen Aktionen gegen den Templerorden, die mit der Verhaftung von 140 Rittern und Großmeister Jacques de Molay begannen. Der Grund für alles waren die hohen Schulden des Königs gegenüber dem mächtigen Orden. Im März 1303 Jacques Molay wurde auf dem Platz öffentlich verbrannt, doch zuvor gelang es ihm, den König und die gesamte Familie der Kapetinger zu verfluchen. Der von Philipp im Jahr 1314 geplante Feldzug gegen Flandern kam aufgrund der Erkrankung des Königs, der am 29. November dieses Jahres verstarb, nicht zustande. Das tragische Ereignis ist mit dem Fluch von Jacques de Molay verbunden.
| Graf von Champagne |
Fontainebleau, Frankreich
Fontainebleau, Frankreich
Charakteristisch
Seine Herrschaft spielte eine wichtige Rolle beim Niedergang der politischen Macht der Feudalherren und der Stärkung des Monarchismus in Frankreich. Er führte die Arbeit seines Vaters und Großvaters fort, aber die Bedingungen seiner Zeit, Charaktereigenschaften und Intrigen der Hofberater führten zeitweise zu Aggression und Grausamkeit in der Politik des Königs. Trotzdem stärkte Philipps Herrschaft den französischen Einfluss in Europa. Viele seiner Aktionen, vom Krieg mit Flandern bis zur Hinrichtung der Templer, zielten darauf ab, den Staatshaushalt aufzufüllen und die Armee zu stärken.
Rechtsstreit mit dem englischen König
Eduard I. ist eine Hommage an König Philipp
Philipps Berater, die im Geiste der Traditionen des römischen Rechts erzogen wurden, versuchten stets, eine „legitime“ Grundlage für die Forderungen und Schikanen des Königs zu finden und gestalteten die wichtigsten diplomatischen Auseinandersetzungen in Form von Gerichtsverfahren. Philipps gesamte Regierungszeit war voller Streitereien, „Prozesse“ und diplomatischer Streitereien der schamlosesten Art.
Nachdem Philipp beispielsweise den Besitz von Guyen für den englischen König Eduard I. bestätigt hatte, rief er ihn nach einer Reihe von Streitereien vor Gericht, da er wusste, dass Eduard, der sich zu dieser Zeit mit den Schotten im Krieg befand, nicht erscheinen konnte. Eduard, der einen Krieg mit Philipp befürchtete, sandte eine Gesandtschaft zu ihm und erlaubte ihm, Guienne vierzig Tage lang zu besetzen. Philipp übernahm das Herzogtum und wollte es den Bedingungen entsprechend nicht verlassen. Es begannen diplomatische Verhandlungen, die zum Ausbruch von Feindseligkeiten führten; aber am Ende gab Philipp Guienne, damit der englische König ihm dennoch den Eid leisten und sich als seinen Vasallen anerkennen konnte. Dies geschah in - gg. Militäraktionen gegen England endeten, weil die Verbündeten der Briten, die Flamen, von unabhängigen Interessen geleitet, begannen, den Norden des Königreichs zu stören.
Flandernkrieg
Philipp IV. gelang es, die flämische Stadtbevölkerung für sich zu gewinnen; Der Graf von Flandern wurde vor der einfallenden französischen Armee fast allein gelassen und gefangen genommen, und Flandern wurde an Frankreich angegliedert. Im selben Jahr, 1301, kam es zu Unruhen unter den eroberten Flamen, die vom französischen Gouverneur Chatillon und anderen Schützlingen Philipps unterdrückt wurden. Der Aufstand breitete sich im ganzen Land aus und in der Schlacht von Kortrijk (1302) wurden die Franzosen vollständig besiegt. Danach dauerte der Krieg mehr als zwei Jahre mit unterschiedlichem Erfolg; Erst 1305 waren die Flamen gezwungen, einen großen Teil ihres Territoriums an Philipp abzutreten, die Vasallenschaft der verbleibenden Ländereien anzuerkennen, etwa 3.000 Bürger zur Hinrichtung auszuliefern, Festungen zu zerstören usw. Der Krieg mit Flandern zog sich vor allem deshalb hin, weil die Aufmerksamkeit Philipps des Schönen durch den Kampf mit Papst Bonifatius VIII. abgelenkt wurde.
Kämpfe mit Papa. Avignon, Gefangenschaft der Päpste

Siegel von König Philipp IV. dem Schönen (1286)
Diese Zustimmung führte jedoch nicht zu einem dauerhaften Frieden mit Philipp, der vom Reichtum der französischen Kirche in Versuchung geführt wurde. Die den König umgebenden Juristen, insbesondere Guillaume Nogaret und Pierre Dubois, rieten dem König, ganze Kategorien von Strafsachen der Zuständigkeit der Kirchenjustiz zu entziehen. Im Jahr 1300 wurden die Beziehungen zwischen Rom und Frankreich sehr angespannt. Der von Bonifatius als Sonderlegat an Philipp entsandte Bischof von Pamiers Bernard Sesse verhielt sich äußerst unverschämt: Er war ein Vertreter jener Partei im Languedoc, die die Nordfranzosen besonders hasste. Der König erhob Klage gegen ihn und verlangte vom Papst, ihm das Priestertum zu entziehen; Dem Bischof wurden nicht nur Beleidigung des Königs, sondern auch Verrat und andere Verbrechen vorgeworfen.
Der Papst reagierte im Dezember 1301 auf Philipp, indem er ihn des Eingriffs in die geistliche Autorität beschuldigte und ihn aufforderte, vor seinem Hof zu erscheinen. Gleichzeitig sandte er dem König die Bulle „Ausculta fili“, in der er die Fülle der päpstlichen Macht und ihre Überlegenheit über alle (ausnahmslos) weltlichen Macht betonte. Der König (der Legende nach hatte er diese Bulle verbrannt) berief im April 1302 die Generalstände ein (die ersten in der französischen Geschichte). Die Adligen und Vertreter der Städte bekundeten ihre bedingungslose Unterstützung für die königliche Politik. Der Klerus wandte sich mit der Bitte an den Papst, nicht nach Rom zu gehen, wo er sie zu dem Konzil berief, das gegen Philipp vorbereitet wurde. Bonifatius war damit nicht einverstanden, aber die Priester gingen trotzdem nicht nach Rom, weil Philipp es ihnen verbot.
Auf dem Konzil, das im Herbst 1302 stattfand, bekräftigte Bonifatius in der Bulle „Unam Sanctam“ erneut seine Meinung über die Vorherrschaft der geistlichen Macht über die weltliche Macht, des „geistigen Schwertes“ über die „weltliche“. Im Jahr 1303 befreite Bonifatius einen Teil des Philipp unterworfenen Landes vom Vasalleneid, und der König berief als Reaktion darauf ein Treffen hochrangiger Geistlicher und weltlicher Barone ein, vor dem Nogaret Bonifatius allerlei Gräueltaten vorwarf.
Bald darauf reiste Nogaret mit einem kleinen Gefolge nach Italien, um den Papst zu verhaften, der dort Todfeinde hatte, was die Aufgabe des französischen Agenten erheblich erleichterte. Papa reiste nach Anagni, ohne zu wissen, dass die Bewohner der Stadt bereit waren, ihn zu verraten. Nogare und seine Gefährten betraten ungehindert die Stadt, betraten den Palast und verhielten sich hier ziemlich unhöflich, fast mit Gewalt (es gibt eine Version über eine Ohrfeige für den Papst). Zwei Tage später änderte sich die Stimmung der Bewohner von Ananya und sie ließen den Papst frei. Wenige Tage später starb Bonifatius VIII. und zehn Monate später starb auch sein Nachfolger Bonifatius IX. Dieser Tod ereignete sich für den französischen König sehr günstig, sodass weit verbreitete Gerüchte ihn auf eine Vergiftung zurückführten.
Die Verwaltung war stark zentralisiert; Dies machte sich besonders in den Provinzen bemerkbar, in denen feudale Traditionen noch stark ausgeprägt waren. Die Rechte der Feudalherren wurden erheblich eingeschränkt (zum Beispiel bei der Münzprägung). Der König war wegen seiner allzu geldgierigen Wirtschaftspolitik nicht beliebt.
Philipps äußerst energische Außenpolitik gegenüber England, Deutschland, Savoyen und allen Grenzbesitztümern, die oft zu einer Vergrößerung der französischen Besitztümer führte, war seine einzige Leistung, die sowohl von seinen Zeitgenossen als auch von den nachfolgenden Generationen geschätzt wurde.
Tod

Posthumer Grabstein von Philipp IV. dem Schönen
Philipp IV. der Schöne starb am 29. November 1314 im Alter von 47 Jahren in seinem Geburtsort Fontainebleau, wahrscheinlich war die Todesursache ein schwerer Schlaganfall. Viele brachten seinen Tod mit dem Fluch des Großmeisters des Templerordens, Jacques de Molay, in Verbindung, der vor seiner Hinrichtung am 18. März 1314 in Paris Philipps Tod in weniger als einem Jahr vorhersagte. Er wurde in der Basilika der Abtei Saint-Denis bei Paris beigesetzt. Sein Nachfolger wurde sein Sohn Ludwig X. der Mürrische.
Familie und Kinder
Er war ab dem 16. August 1284 mit Johanna I. (11. Januar 1272 – 4. April 1305), Königin von Navarra und ab 1274 Gräfin von Champagne, verheiratet. Diese Ehe ermöglichte die Annexion der königlichen Domäne Champagne und führte auch zur ersten Vereinigung Frankreichs und Navarras im Rahmen einer Personalunion (bis 1328).
Aus dieser Verbindung gingen sieben Kinder hervor:
Obwohl Philipp IV. noch ein recht junger Witwer (37 Jahre alt) war, heiratete er nicht erneut und blieb der Erinnerung an seine verstorbene Frau treu.
siehe auch
Literatur
- Dominique Poirel. Philippe le Bel. Perrin, Sammlung: Passé Simple, Paris, 1991. 461 S. ISBN 978-2-262-00749-2
- Sylvie Le Clech. Philippe IV. der Bel et les derniers Capétiens. Tallandier, Sammlung: La France au fil de ses rois, 2002 ISBN 978-2-235-02315-3
- Georges Bordonove. Philippe le Bel, roi de fer. Le Grand livre du mois, Paris, 1984 ISBN 978-2-7242-3271-4
- Joseph Strayer. Die Herrschaft Philipps des Schönen. 1980.
- Favier, Jean. Philippe le Bel
- Boutaric. La France unter Philippe le Bel. S. 1861
- Lustig. Philippe le Bel. S., 1869
- B. Zeller. Philippe le Bel und seine drei Kinder. S., 1885
- Maurice Druon. Eiserner König. Das erste Buch der „Cursed Kings“-Reihe (Der Eiserne König. Der Gefangene von Chateau-Gaillard. Übersetzt aus dem Französischen. M., 1981)
Links
| Faciens misericordiam – 12. August 1308 | |
|---|---|
| Kommissare | Gilles Aycelin Guillaume Durand Guillaume de Bonnet Raynaud de La Porte Matthieu de Naples Jean de Mantoue Jean de Montlaur Guillaume Argani |
| Protagonisten | Clemens V Philipp der Schöne |
| Andere | Templer Jacques de Molay |
| Portal:Templer | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||